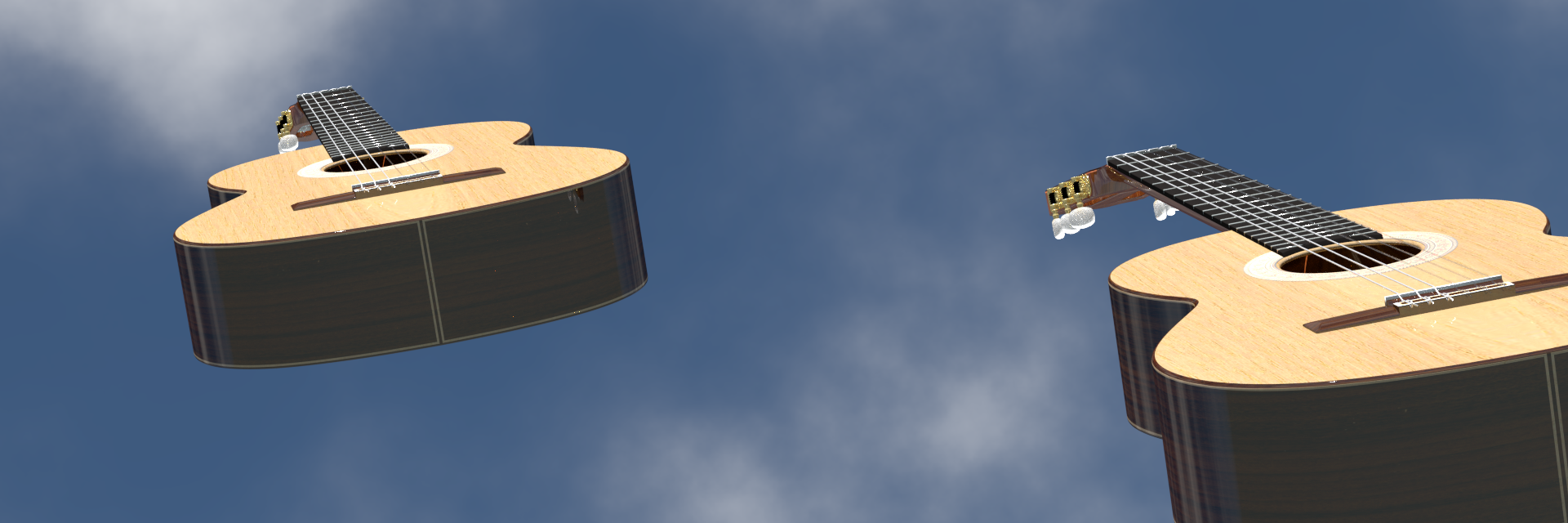Repräsentationsmeditationen – 1
Ich lese momentan Psychology for Musicians und bin wieder auf ein Thema gestoßen, was mich immer wieder beschäftigt: Wie sieht es im Kopf aus, wenn man übt und musiziert. Wie soll es aussehen?”
Dies waren Fragen, die mir meine Lehrer eigentlich selten beantwortet haben. Ab und zu waren sie – glaube ich – genervt.
Das erste Mal gaben mir zufällig entdeckte Bücher aus den Anfangszeiten des Neurolinguistischen Programmieren viele Möglichkeiten in meinem Kopf zu experimentieren.
Das Modell des TOTE und die damit verbundenen Aussagen faszinierten mich sehr.
TOTE steht für Test-Operate-Test-Exit. Man führt eine Handlung so lange aus bis das Handlungsergebnis mit der Zielvorstellung übereinstimmt.
Die damit verbundene Aussage war, wie schwer oder leicht wir das Ergebnis erreichen, hängt auch davon ab, wie wir die Zielvorstellung gestalten. Diese Zielvorstellungen werden Repräsentation genannt.
Repräsentationen im Bereich der Musik können
- auditiv
- kinästhetisch
- visuell
- motorisch
- kognitiv
sein.
Vielleicht trügt mich meine Erinnerung, aber auf was für eine Art und Weise ich meine Stücke in mir repräsentiere, ist selten bis gar nicht von meinen Lehrern hinterfragt worden. In Lehrproben, Methodik und Psychologievorlesungen wurde diese Frage auch nicht thematisiert.
Das liegt vermutlich daran, dass an einem Konservatorium oder Musikhochschule nur Menschen sind, die in geeigneter Form repräsentieren und damit keine Notwendigkeit der Thematisierung besteht.
Ebenfalls ich fand die Experimente, wie stelle ich mir die Sachen vor und was bewirkt das für mein Spielen, als sehr ergiebig.
Zurück zu dem TOTE-Modell. Die erste Frage lautet, wie kommt man zu einer Repräsentation. Der übliche Weg in der Musik dürfte sein, in dem man die Sachen macht, bilden sich im Laufe der Zeit Repräsentationen aus.
Die Repräsentation wird dabei eigentlich nur indirekt überprüft. Wenn das Ergebnis stimmt, wird die Repräsentation schon richtig sein.
Fordert man aber bei einem mehrstimmigen Stück den Schüler auf die Unterstimme zu singen, versagen viele. Die Oberstimme macht weniger Probleme. Ich glaube, dieses ist ein bekannter Sachverhalt.
Was sich damit erklären lässt, dass jeder ein bevorzugtes Repräsentationssystem hat. Das heißt mancher stellt sich erst einmal lieber kinästhetisch vor, der andere visuell und mancher auch auditiv. Ich vermute mal ganz stark, dass man in diesen Repräsentationsmodi verharrt und die anderen Repräsentationsformen unterentwickelt bleiben.
Legt man das Unterstimmenbeispiel zu Grunde, heißt das, ist das äußere Ergebnis korrekt, ist das kein Zeichen dafür, dass die Repräsentationen in den verschiedenen Repräsentationsmodi vollwertig ausgebildet sind.
Die Frage die mich beschäftigt, soll man sich um Repräsentationen gezielter kümmern?
Der Beitrag wurde am Freitag, den 29. April 2011 um 08:15 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Gitarre lernen, Gitarrenunterricht, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .