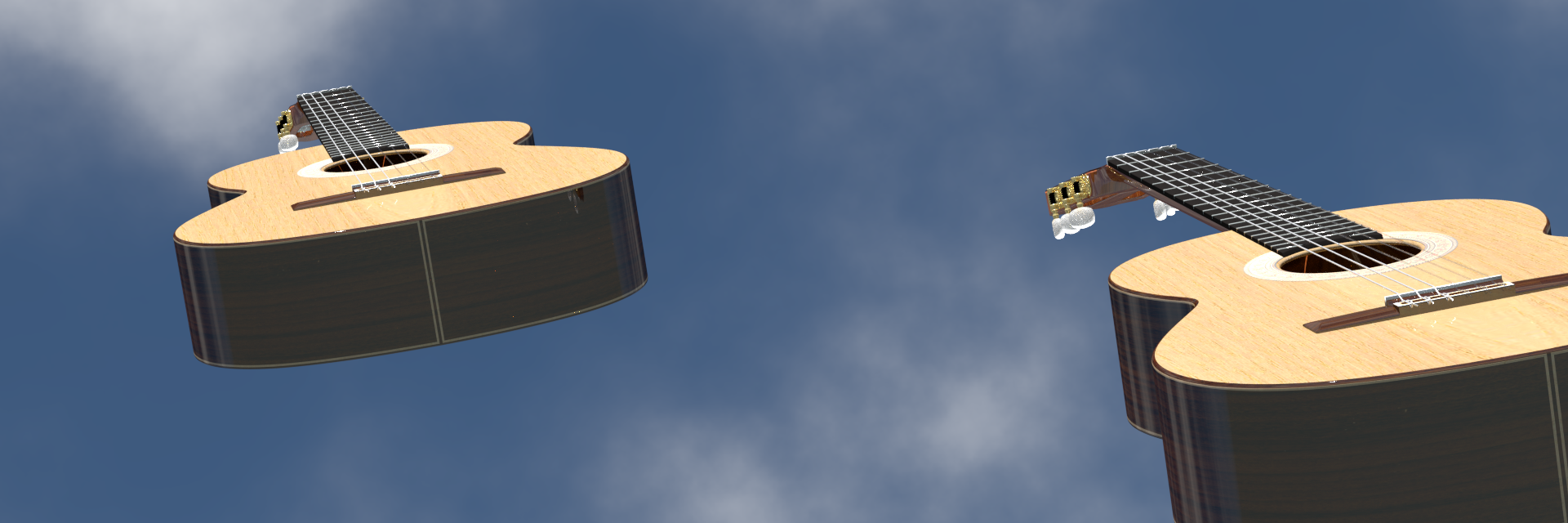Repräsentationsmediationen – 8
Ich habe mein Verhalten im Kopf weiter beobachtet und dabei etwas festgestellt, was ich zwar schon einige Male angesprochen habe, aber dessen Bedeutung mir erst jetzt auffällt.
Momentan lerne ich wieder mal ein paar Stücke nach Gehör. Es gibt welche, die kann ich problemlos nachsingen. Ich mache mir nicht einmal große Gedanken, wie die Töne heißen, mit was für musiktheoretischen Begriffen ich operieren müsste. Dann gibt es aber auch ein Stück von Bach, wo ich an manchen Stellen meine lieben Probleme habe, die Stelle auf Anhieb nachzusingen. Wenn ich mir aber die Stelle theoretisch klarmache, kann ich sie singen. Aber ich muss immer wieder zu der theoretischen Hilfestellung greifen, um die Töne zu treffen.
Ich habe nicht versucht, wenn ich lang genug probiere, ob ich ohne die theoretische Hilfestellung die Stelle nachsingen kann. Dazu war ich zu ungeduldig.
Warum halte ich diese Beobachtung für so wichtig. Es gibt ja verschiedene musikpädagogische Ansätze, die darauf zielen, dass der Schüler auf eine bestimmte Art und Weise in seinem Kopf mit der Musik umgeht.
Vielleicht wäre es eine andere Herangehensweise an das Problem, dass der Schüler mit der angestrebten inneren Technik nicht überfordert wird, weil er sonst in andere mentale Techniken ausweichen muss.
Aber ich habe auch eine andere Sache beobachtet. Wenn ich nach Noten ein Stück lerne, dann sind meine Repräsentationen anders, als wenn ich nach Gehör lerne.
Es ist jetzt nicht, dass ich mir andere Dinge vorstelle. Aber die Beziehungen der Repräsentationen untereinander verändern sich.
Der Hauptunterschied ist, lerne ich nach Noten, ruft die motorische Vorstellung den Klang wach. Lerne ich nach Gehör, ruft der Klang die Vorstellung der Motorik wach.
Warum scheint mir das bemerkenswert.
Bei meinem Selbstexperiment ist mir ein Mechanismus deutlich geworden. Um mir das Gehörte besser zu merken, griff ich zu verschiedenen Dingen. Ich merkte mir die Töne, beschrieb den Verlauf der Melodielinie etc., etc.
Das tue ich auch, wenn ich nach Noten lerne. Aber diese Merkhilfen schieben sich dann in meinem Kopf mehr in den Vordergrund. Ich “verheddere” mich quasi in ihnen.
Mich beschleicht auf Grund dieser Erfahrungen der Verdacht, dass im Laufe der Geschichte, dass das Pferd beim Erlenen von Musik allmählich von hinten aufgezäumt wurde.
Zu erst hat man Musik oral übermittelt. Ab einem bestimmten Komplexitätsgrad braucht man Merkhilfen. Irgendwann hat man angefangen Musik sich über die standardisierten Methoden des Merkens zu erarbeiten. Bloß dadurch werden vielleicht auch die Dinge im Kopf von hinten aufgezäumt und unbegabtere Schüler bleiben an einem Punkt des Weges -dem falschen vermutlich- hängen. Bei meinem Vorspiel-Nachspiel-Episoden im Unterricht greife ich auch mal auf gerade geübte Stücke zurück, ohne zu verraten, was ich da vorspiele. Es gibt immer wieder Schüler, die nicht merken, dass sie gerade ihre Hausaufgaben nachspielen. Sie glauben es teilweise auch nicht, wenn ich es ihnen sage.
Es herrscht zwar ein gewisses Unbehagen in der Instrumental- und Musikpädagogik über diesen Zustand. Aber konkrete Untersuchungen zu diesem Thema oder Handlungsanleitungen sind mir nicht bekannt. Es liegt vielleicht daran, dass das logistische Problem, was zu lösen wäre, bisher nicht so recht lösbar ist oder war.
Momentan gehe ich bei dem nach Gehör lernen sehr frei vor. Entweder ich kann es singen oder spielen. Teilweise findet auch keine genauere Reflexion darüber statt, was ich da unter musiktheoretischen Begriffen spiele. Hauptsache es funktioniert.
Bevor sich jemand wundert, wie man etwas spielen kann, ohne dass man weiß, um was es sich handelt. Zum Beispiel ich habe in der Melodie einen Sprung vom g zum b abwärts. Intuitiv finden meine Finger den Weg zum b. Wenn ich daneben lange, suche ich die richtige Tonhöhe. Die Größe des Intervalls mache ich mir nicht klar.
Da ich aber an anderer Stelle behauptet habe, dass die musiktheoretische Analyse des Gehörten und Gespielten erleichtern würde, bei neuem Material eine auditive Vorstellung wachzurufen, handle ich eigentlich gegen meine eigene Erkenntnis.
Aber dies ist eigentlich nicht das Problem, sondern auch hier wieder, ich baue mir selbst wohlmeinend ein Setting, um meine auditiven Fähigkeiten zu trainieren, könnte dies aber effizienter gestalten. Tue dies nicht, obwohl ich in einer anderen Ecke des Kopfes es besser weiß.
Auch hier wieder, es herrscht zu wenig Kontrolle darüber, was im Kopf passiert. Da das aber mein Kopf ist und ich eigentlich seine Vorgehensweise kontrollieren will, ist die Frage, wie sieht das im Unterricht aus, wo ich eigentlich in die Köpfe anderer eingreifen soll?
Offen gesagt ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Weil es eigentlich kein Thema ist, ist es so, dass hier vielleicht viel Potential in der Kontrolle der Vorstellungen steckt, um Unterricht und Üben effektiver zu gestalten.
Der Beitrag wurde am Freitag, den 24. Juni 2011 um 08:13 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Gitarre lernen, Gitarrenunterricht, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .